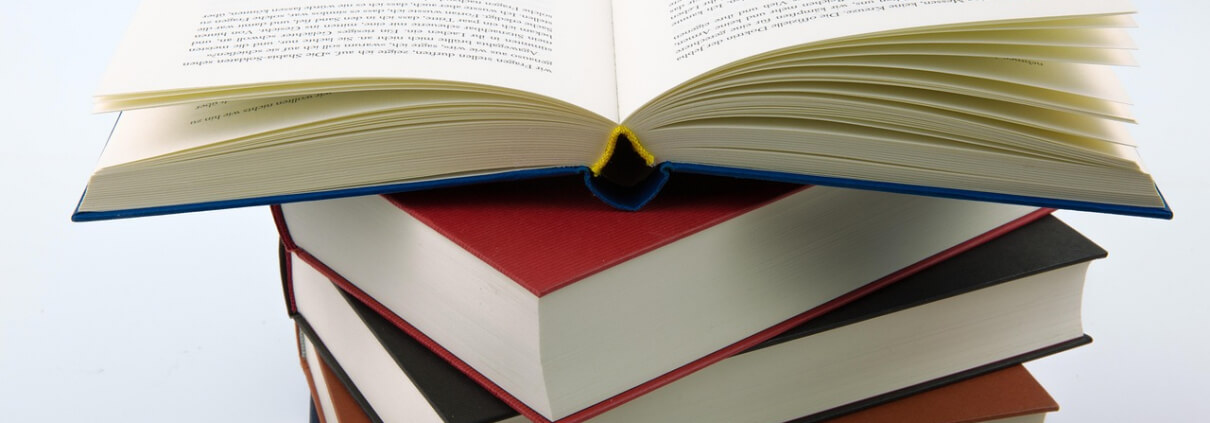Wie Hausübung leichter wird: Einfühlsame Wege für neurodivergente Kinder
Hausübung kann für neurodivergente Kinder oft eine besondere Herausforderung sein. Die Schule kostet viele von ihnen enorm viel Energie – und danach noch die notwendige Motivation und Konzentration für die Hausübung aufzubringen, ist häufig eine unüberwindbare Hürde.
Mit den folgenden Strategien kannst du Hausaufgaben jedoch zu einem entspannteren, manchmal sogar positiven Erlebnis machen.
1. Einen festen, klaren Ablauf schaffen
Routine und Struktur sind für viele neurodivergente Kinder von großer Bedeutung. Ein klar strukturierter Ablauf hilft ihnen zu wissen, was kommt, und reduziert Unsicherheit.
Daher ist es hilfreich, auf feste, möglichst gleichbleibende Zeiten sowie eine klare Reihenfolge bei der Hausübung zu achten, zum Beispiel: zuerst Mathe, dann Deutsch oder erst Rechnen, dann die Leseübung.
Visuelle Pläne mit Symbolen unterstützen zusätzlich dabei, dass das Kind weiß, was wann dran ist.
2. Den Arbeitsplatz optimieren
Die Umgebung hat einen enormen Einfluss auf die Konzentration. Deshalb ist es sinnvoll, Tisch und Umgebung möglichst reizarm zu gestalten:
- kein Spielzeug in Reichweite
- möglichst wenig Geräusche (gegebenenfalls Gehörschutz verwenden)
- Raum abdunkeln
- den Lichtstrahl der Schreibtischlampe gezielt auf die Aufgabe richten
Wenn es drinnen nicht funktioniert, kann auch ein ruhiger Ort im Freien oder ein stilles Eck in einem Café helfen, damit die Hausübung überhaupt begonnen werden kann.
Wichtig ist außerdem, Optionen anzubieten: Hausaufgaben können – je nach Bedarf – stehend, sitzend oder nach Möglichkeit auch liegend erledigt werden.
3. Aufgaben in kleine Schritte aufteilen
Große Aufgaben können schnell überwältigend wirken. Deshalb ist es hilfreich, sie in kleine, klar umrissene Schritte zu zerlegen.
Zum Beispiel:
- Eine Autostraße auf ein Blatt Papier zeichnen und die Aufgabenabschnitte einzeichnen. Nach jedem erledigten Teil darf das Kind mit dem Auto ein Stück weiterfahren.
- Alternativ können auch die Schienen einer Spielzeugeisenbahn verwendet werden: Pro erledigtem Aufgabenteil kommt ein Schienenstück dazu.
Zusätzlich können Zeitslots helfen:
Kurze Zeitfenster von etwa 10–15 Minuten pro Aufgabenabschnitt. Danach wird das Kind gefragt, ob es eine Pause braucht oder weitermachen möchte.
4. Multisensorisches Lernen einbeziehen
Neurodivergente Kinder profitieren oft davon, wenn mehrere Sinne gleichzeitig angesprochen werden:
Farben & Marker: Wichtige Informationen farblich hervorheben oder mit farbigen Post-its die Zeile markieren, in der etwas geschrieben werden soll.
Bewegung: Aufgaben lassen sich gut mit kleinen Bewegungen kombinieren, zum Beispiel mit Vokabelkarten an der Wand. Zwischendurch kann das Kind einmal um den Tisch gehen oder kurz zur Lieblingsmusik tanzen. Auch ein Gummiband zwischen den Sesselbeinen kann helfen, den Bewegungsdrang auszuleben.
Hören & Sehen: Das vertraute Lieblingshörspiel im Hintergrund laufen lassen, während das Kind Buchstaben oder Wörter schreibt. Alternativ Audio-Versionen von Texten oder Diktate abspielen.
5. Motivation und Belohnung
Motivation ist ein zentraler Faktor bei der Hausübung. Belohnung muss dabei nicht immer etwas Süßes sein. Je nach Interesse des Kindes eignen sich zum Beispiel:
- Sticker aufkleben
- eine Folge der Lieblingsserie schauen dürfen
- ein gemeinsamer Spaziergang
Um die Motivation zu steigern, können Aufgaben spielerisch gestaltet werden, etwa als kleines Spiel, bei dem Punkte gesammelt werden.
6. Emotionale Unterstützung und Geduld
Stress und Frustration können Lernen blockieren. Umso wichtiger ist emotionale Begleitung:
Gefühle benennen, zum Beispiel:
„Ich sehe, dass dich das nervt / dass das anstrengend für dich ist. Lass uns gemeinsam überlegen, wie wir es leichter machen können.“
Pausen zulassen, wenn das Kind unruhig oder überdreht wird und nichts mehr weitergeht, z. B. durch kurze Atemübungen, Bewegung, etwas zum Kneten oder ein Glas Wasser.
Wenn die Hausübung erledigt ist, das Bemühen anerkennen, nicht nur das Ergebnis.
7. Kommunikation mit Lehrkräften
Ein regelmäßiger Austausch mit Lehrpersonen kann helfen, Aufgaben besser an das Kind anzupassen. Eventuell kann der Umfang der Aufgaben verändert oder reduziert werden.
Auch Feedback ist wertvoll: Wenn etwas zu Hause gut funktioniert, lohnt es sich, dies der Lehrkraft mitzuteilen. So können hilfreiche Strategien auch im Schulalltag angewendet und Überforderung reduziert werden.
Fazit
Hausübung muss kein Kampf sein – es gibt Möglichkeiten.
Mit klarer Struktur, kleinen Schritten, Motivation, Belohnung und emotionaler Unterstützung können neurodivergente Kinder selbstständiger, motivierter und entspannter lernen. Entscheidend ist ein Rahmen, der Sicherheit gibt und individuelle Lernwege zulässt.